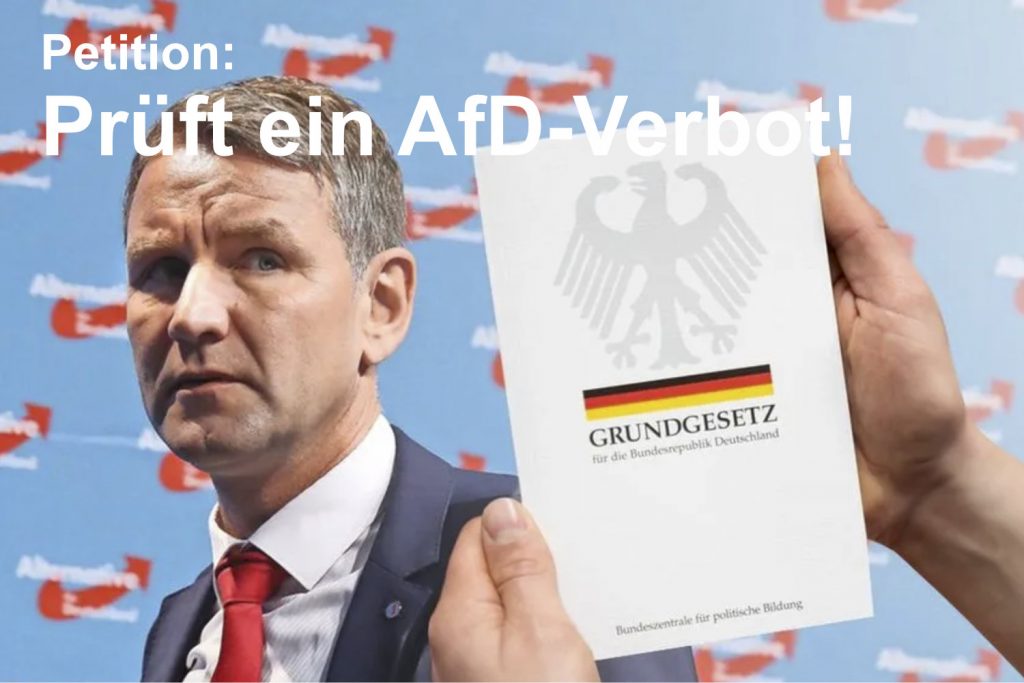2. Dez 2023 | Alle, Aktuelles, ELSA-Zeitung, In eigener Sache, Gonsenheim
In dieser Ausgabe:
- Kultur im Stadtteiltreff
- Wünsch Dir was
- Kinderrechte
- Lesen macht stark
- Fotoausstellung
- und, und, und …
Die Online-Ausgabe steht auf unserer Homepage zum Download bereit.
Die gedruckte Ausgabe ist wie gewohnt ab nächster Woche erhältlich.

13. Nov 2023 | Alle, Aktuelles, In eigener Sache
Appell: werden Sie Mitglied im Stadtteiltreff Gonsenheim. Die mittelfristige Finanzierung der Einrichtung muss jetzt abgesichert werden
Um die Finanzierung des Stadtteiltreffs im Jahr 2023 macht sich Dieter Pieroth, der Vorsitzende des Vereins, derzeit weniger Sorgen. Man habe im laufenden Jahr vorsichtig gewirtschaftet und werde bis zum Jahresende alle Ausgaben begleichen können. Das kommende Jahr 2024 müsse uns aber Kopfzerbrechen bereiten, so Pieroth. Aufgrund der massiven Kostensteigerungen, die allerorts zu spüren seien, werde es schwierig, die bisherigen Ausgaben zu stemmen. Der Vorstand will auf keinen Fall durch Einsparmaßnahmen, insbesondere nicht in der personellen Ausstattung, reagieren müssen. Daher gelte es jetzt dafür zu sorgen, dass sich die Einnahmesituation des Vereins verbessere.
 Der Stadtteiltreff ist hierzu in Gesprächen mit der Stadt Mainz bezüglich der Förderung der Gemeinwesenarbeit, insbesondere über die Ausstattung der niedrigschwelligen allgemeinen Lebensberatung wird gesprochen. Sozialminister Alexander Schweitzer war ebenfalls zu Besuch im Stadtteiltreff und konnte zusagen, dass er sich für weitere finanzielle Hilfen des Landes aussprechen wolle.
Der Stadtteiltreff ist hierzu in Gesprächen mit der Stadt Mainz bezüglich der Förderung der Gemeinwesenarbeit, insbesondere über die Ausstattung der niedrigschwelligen allgemeinen Lebensberatung wird gesprochen. Sozialminister Alexander Schweitzer war ebenfalls zu Besuch im Stadtteiltreff und konnte zusagen, dass er sich für weitere finanzielle Hilfen des Landes aussprechen wolle.
Schön wäre es nun, wenn es uns in Gonsenheim gemeinsam gelingt, den Anteil der Eigenmittel des Vereins zu steigen. Mitgliedsbeiträge, deren Höhe man beim Stadtteiltreff Gonsenheim ab 25 € im Jahr aufwärts frei wählen kann, sind hierfür das effektivste Mittel, da sie jedes Jahr verlässlich eingehen. Der Vorstand wendet sich daher an die Gonsenheimer mit einem Appell: Werden Sie Mitglied im Stadtteiltreff Gonsenheim. Helfen Sie mit ihrem Mitgliedsbeitrag, die wichtige Nachbarschaftsarbeit der Einrichtung abzusichern. Die Angebote für alle Altersgruppen, den Brotkorb, die Flüchtlingsarbeit oder auch diese Zeitung für Gonsenheim. Wenn Sie mögen, kommen Sie einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung, um über unsere Aktivitäten informiert zu werden und die Belange des Stadtteiltreffs mit uns zu lenken. Der Stadtteiltreff ist wichtig für Gonsenheim, durch viele Mitglieder im Verein untermauern wir diese Bedeutung.
Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, den Stadtteiltreff Gonsenheim auch einmalig zu unterstützen. Auf der Spendenplattform „Heimathelden“ der Volksbank Alzey Worms sammeln wir zurzeit Geld, um unsere Idee einer Gedenkstele an die Opfer von Hinrichtungen auf dem Großen Sand zu realisieren. Sie können eine Patenschaft für Kinder übernehmen, um mit Ergänzungsbeiträgen das Erlernen eines Instrumentes zu ermöglichen. Oder spenden Sie Geld zur Finanzierung unserer Lebensmittelhilfe in der Housing Area. Sie können themen- und projektbezogen spenden, wenden Sie sich dafür einfach an die Mitarbeiter*innen der Einrichtung. Wir freuen uns über Aktionen, die zu Gunsten des Stadtteiltreffs durchgeführt werden, zum Beispiel Konzerterlöse, Spendensammlung anlässlich von Geburtstagen oder bei Trauerfeiern.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wenden Sie sich gerne an die Mitarbeitenden oder Vorstandsmitglieder des Stadtteiltreff Gonsenheim, wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen! Auf eine gute Nachbarschaft!)
(hes)
Spendenkonto:
DE10 5509 1200 0081 8439 02

9. Nov 2023 | Alle, Aktuelles
Aus einem Newsletter von MUSIK MASCHINE
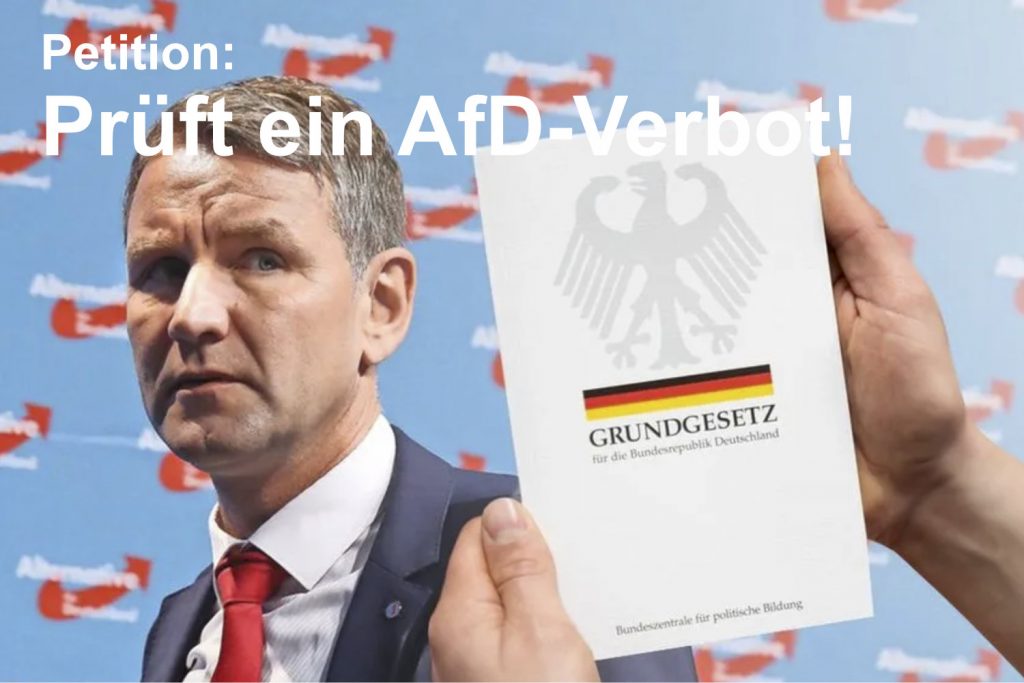 Kommen wir kurz zu etwas ganz anderem …
Kommen wir kurz zu etwas ganz anderem …
Bevor wir uns hier weiter über unser (wie üblich wunderschönes) Konzertprogramm auslassen, möchte ich kurz etwas Politisches einschieben. Das ist hier in diesem Newsletter extrem selten, denn die Musikmaschine möchte euch unterhalten und fantastische gemeinsame Erlebnisse schaffen. Da wir dabei aber natürlich nicht taub und blind sind und auch nichts verdrängen wollen, sondern im Kulturschaffen und -besuchen an sich schon eine politische Handlung sehen, ist das folgende hier aus meiner Sicht nicht fehl am Platz, auch wenn es eventuell schwer zu verdauen ist.
Wir machen zurzeit alle viel durch. In den vergangenen wenigen Jahren sind wir mit der Corona-Pandemie, dem Angriff Russlands auf die Ukraine, den diversen Gas-, Öl-, und Wirtschaftskrisen und zuletzt auch noch mit dem Hamas-rontiert gewesen. Nicht zu vergessen: Über alldem hängt noch das Damokles-Schwert Klima-Katastrophe. Das schlaucht enorm. Macht vielleicht auch wütend oder müde und resigniert. Auch wenn die ganzen Krisen für uns hier in Deutschland natürlich überhaupt nicht so dramatisch sind, wie für die Menschen in den Brennpunkten und Krisengebieten überall auf der Welt, sind solche Frustgefühle sicher verständlich.
Angesichts der ganzen komplexen und vertrackten Situationen, die gefühlt immer häufiger werden und für die es scheinbar keine gute Lösung gibt, ist es wohl auch verständlich, wenn man sich Einfachheit und Leichtigkeit wünscht.
Was aber ÜBERHAUPT NICHT zu verstehen ist:
Wie man SCHON WIEDER auf den absurden Gedanken kommen kann, dass irgendwelche einzelnen kleinen und meist schwachen Gruppen schuld an der Misere sein sollen bzw. dass es vielleicht etwas helfen könnte, diese Gruppen auszuschließen.
Wie man SCHON WIEDER selbstzufrieden, gedankenverloren und zynisch wahlweise auf “Flüchtlinge” oder “die da oben” hetzen oder einen von solch scheußlichen Begriffen wie “die Hochfinanz” geprägten Antisemitismus pflegen kann.
Wie man SCHON WIEDER nicht verstehen kann oder will, dass diese schleichend wachsende Unmenschlichkeit aus einer ganz bestimmten Richtung und von ganz bestimmten Personen kommt; die wir alle kennen.
Warum wir in Deutschland, dem Land, das den 2. Weltkrieg verbrochen hat, SCHON WIEDER einer Gruppe von geistigen Brandstiftern die Möglichkeit geben, unsere Toleranz und Menschlichkeit, kurz: die Demokratie zu attackieren.
Ich will nicht nichts unternehmen, hatte aber ganz lange keine Idee, wie man als Einzelne:r helfen soll. Die AfD versucht, den Diskurs dadurch zu verschieben, dass sie schlicht am lautesten schreit. Weil so viele sich nur denken “was ein Schwachsinn” und nichts erwidern, erscheinen die zynischen AfD-Botschaften größer und wichtiger.
Deswegen bitte ich euch: Erwidert etwas! Diskutiert darüber! Wehrt euch! Schützt die Menschlichkeit lautstark!
Ich will verhindern, dass diese Brandstifter Erfolg haben und uns alle in den nächsten Abgrund treiben. Deswegen will ich, dass ein Verbot dieser Partei geprüft wird. Wenn das Erfolg hätte, wären die Möglichkeiten dieser Partei sehr deutlich eingeschränkt – keine Ämter, keine Posten, kein Geld mehr aus der Staatskasse! Bitte macht mit, die entsprechende Petition findet ihr durch einen Klick auf den Button.
Zur Petition:
https://innn.it/afdverbot
[…]
Liebe Grüße, Moritz Eisenach

2. Nov 2023 | Alle, Aktuelles, Ausstellung, In eigener Sache, Gonsenheim, Kultur, Veranstaltung
Photoausstellung von Roman Hirsch
vom 31.10. bis 21.12. im Stadtteiltreff Gonsenheim
Mo – Do, jeweils 14:00 bis 17:00 Uhr
Vernissage
am 31.10. – 19:00 Uhr
Sonderöffnung in Anwesenheit des Künstlers
am 03.12. um 18:00

28. Okt 2023 | Alle, Aktuelles, ELSA-Zeitung, In eigener Sache, Gonsenheim
In dieser Ausgabe:
- Droht dem Stadtteiltreff eine neue Finanzkrise?
- Kinderarmut
- Aufruf AfD-Verbotspetition
- Ukrainische Theatergruppe
- Nachruf Christine und Kurt Rosenthal
- Termine, Veranstaltungshinweise, Buchtipps
- und, und, und …
Die Online-Ausgabe steht auf unserer Homepage zum Download bereit.
Die gedruckte Ausgabe ist wie gewohnt ab nächster Woche erhältlich.